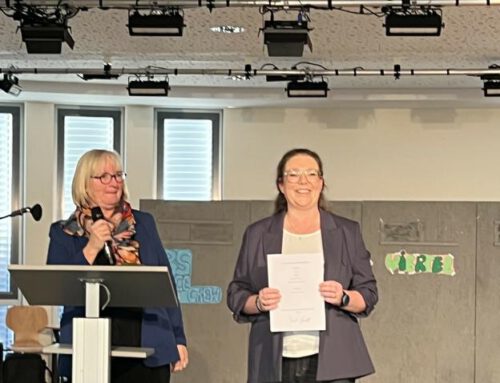Podiumsgespräch zum Nahostkonflikt
Am vergangenen Dienstag hatten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10 bei einer Podiumsdiskussion Gelegenheit, sich intensiv mit dem Nahostkonflikt auseinanderzusetzen. Die Terror-Anschläge durch die Hamas vom 7. Oktober 2023 und die darauf folgende militärische Antwort Israels bewegen hierzulande viele Menschen. Dabei scheint der Nahostkonflikt so alt wie unlösbar zu sein. Die Meinungen, wer eigentlich Schuld an der wiederkehrenden Gewalt in Israel und Palästina trägt, stehen einander oft unversöhnlich gegenüber. Umso wichtiger ist es, die Stimmen zu stärken und zu hören, die trotz der verhärteten Lager für Dialog und Empathie eintreten.
Gut, dass wir mit Nazih Musharbash einen Gast gewinnen konnten, der sich nicht nur für die Einhaltung der Menschenrechte engagiert, sondern auch eine große Expertise zur Geschichte und Gegenwart von Nahost teilen kann. Musharbash wurde 1946 in Jordanien geboren und ging als christlicher Palästinenser in Bethlehem auf ein deutsches Internat. Seit 1965 lebt er in Deutschland, aber bewegt sich regelmäßig zwischen seinen „drei Heimaten im Herzen“, Jordanien, Palästina und Deutschland. Bis zu seiner Pensionierung engagierte er sich in Deutschland erst als Schulleiter der ehemaligen Haupt- und Realschule hier in Bad Laer. Dann wurde er Abgeordneter für die SPD im Kreistag Osnabrück und im niedersächsischen Landtag. Seit 2018 setzt sich Musharbash öffentlich für die Interessen der palästinensischen Bevölkerung in Nahost ein, wo er viele Freunde hat, die unmittelbar vom derzeitigen Krieg betroffen sind. Doch Musharbash ist nicht nur mit Palästinensern, sondern auch mit zahlreichen jüdischen Israelis und jüdischen Deutschen befreundet. Auch jetzt, im Angesichts der Schreckens, in dem sowohl Israelis als auch Palästinenser leben, steht er mit ihnen in Kontakt.
Pia und Donya (Jg. 9), Sophie-Marie und Finn Connor (Jg. 10) moderierten souverän das Gespräch und stellten die Fragen, die sie während ihrer intensiven Vorbereitung in den WPK-Kursen Politik von Frau Hinz, Herrn Berdelmann und Herrn Saathoff entwickelt hatten. Ob man den einen Schuldigen in diesem Konflikt ausmachen könne, wollten sie zu Beginn wissen. Einfache Antworten und einseitige Verurteilungen möge er nicht, betonte Musharbash. Beide Seiten, Palästinenser wie Israelis, müssten anerkennen, dass sie in diesem Konflikt sowohl Opfer als auch Täter seien. Und er warnte davor, in die Falle zu tappen, den Nahostkonflikt als eine religiöse Auseinandersetzung zu verstehen. Dies würde zwar von den religiösen Extremisten auf beiden Seiten so gesehen, doch grundsätzlich gehe es um das Problem, dass „zwei Völker Anspruch auf das gleiche Land erheben“. Und so eine Frage lasse sich prinzipiell politisch lösen. Doch sowohl das nationalreligiöse Lager in Israel als auch die fundamentalistischen Gruppen wie die Hamas in den palästinensischen Gebieten seien an einer Lösung nicht interessiert. Sie wollten jeweils das ganze Land für sich. Umso bitterer sei es, dass vor über 20 Jahren ein Frieden schon ganz nahe schien als Israelis und Palästinenser sich im Rahmen der Osloer Friedensgespräche aufeinander zubewegten. Seitdem jedoch geben sowohl in Israel als auch im Gaza-Streifen immer mehr die religiösen Extremisten den Ton an: terroristische Angriffe von der Hamas auf der einen, „Staatsterror“ in Form von Landnahme durch Israel auf der anderen Seite.
Auf die Frage der Moderierenden, was langfristig zu einem Frieden führen könnte, antwortete Musharbash eindrücklich, dass in seinen Augen nur die Jugend dazu in der Lage sei. Die älteren Generationen, die führenden Politiker, seien zu verstrickt in die Jahrzehnte andauernde Feindschaft. Die Jugend jedoch wolle eine Zukunft. Deshalb sei es so wichtig, dass es schnell zu einem dauerhaften Waffenstillstand komme, um eine Pause in die Spirale des Hasses zu bringen: „Die Jugend in Gaza hat in den letzten 15 Jahren fünf Kriege erlebt und dieser hier ist der bislang schlimmste. 15 oder 20 Jahre ohne Krieg, das wäre notwendig, damit die Jugend aufatmen kann und versteht, was Frieden sein könnte“. Nur so lasse sich der Kreislauf der Gewalt durchbrechen. Welche Rolle Deutschland hier einnehmen sollte, fragten ihn die Schülerinnen und Schüler. „Deutschland trägt aufgrund des Holocausts eine besondere Verantwortung dafür, dass Jüdinnen und Juden einen eigenen Staat haben, der sie schützt“, so Mushabarsh, „doch genauso hat Deutschland eine Verantwortung gegenüber den Palästinenserinnen und Palästinensern, die seit der Gründung Israels keinen Staat haben, der sie schützt“.
Mit diesen Worten schloss Musharbash vor sichtlich bewegten Schülerinnen und Schülern, bei denen er sich für ihr Engagement, ihre klugen Fragen und ihr Interesse sichtlich berührt bedankte. Sein Besuch und seine eindrücklichen Schilderungen haben uns sensibilisiert, dass es eben selten einfache Antworten gibt, auch wenn sie noch so verlockend zu sein scheinen. Diesen Gedanken griff auch Herr Berdelmann bei der Verabschiedung auf, als er Herrn Musharbash überreichte: „Es ist immer leicht, der Mehrheit zu folgen. Umso mehr Anerkennung gebührt denen, die den Mut aufbringen, unbequem zu sein. Wir leben glücklicherweise nicht mehr in einer Diktatur wie dem Nationalsozialismus und müssen uns nicht, wie die Mitglieder der weißen Rose, um unser Leben fürchten, wenn wir frei sprechen. Dennoch ist es anstrengend und verlangt Kraft, sich mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen und für diese öffentlich einzustehen.“
Text: R.Saathoff
Fotos: A.Hinz